Tristan und Isolde » Richard Wagner » Partituranalyse
Tristan und Isolde - Vorspiel - Takt 1-33 » Partituranalyse
Übungshinweis zur Partitur [ Tristan und Isolde - Vorspiel - Takt 1-33 ]
Lesen Sie zuerst die Partitur „stumm“, um die innere Vorstellungskraft zu entwickeln. Jetzt starten Sie das Tondokument und verfolgen dabei im Partiturbild die Musik. Partitur zu „Tristan und Isolde - Vorspiel - Takt 1-33“ von Richard Wagner. Versuchen Sie dabei an der richtigen Stelle über das Betätigen der Registerkarten in das nächste Partiturbild zu wechseln. P.S.: Sie können auch über die Verwendung ihrer Pfeiltasten Ihrer Tastatur die Registerkarten wechseln.
Downloads Ressourcen zu [ Tristan und Isolde - Vorspiel - Takt 1-33 ]
Notenbilder zu"Tristan und Isolde - Vorspiel" von Richard Wagner
- Takt 1 bis 6
- Takt 7 bis 12
- Takt 13 bis 19
- Takt 20 bis 26
- Takt 27 bis 33
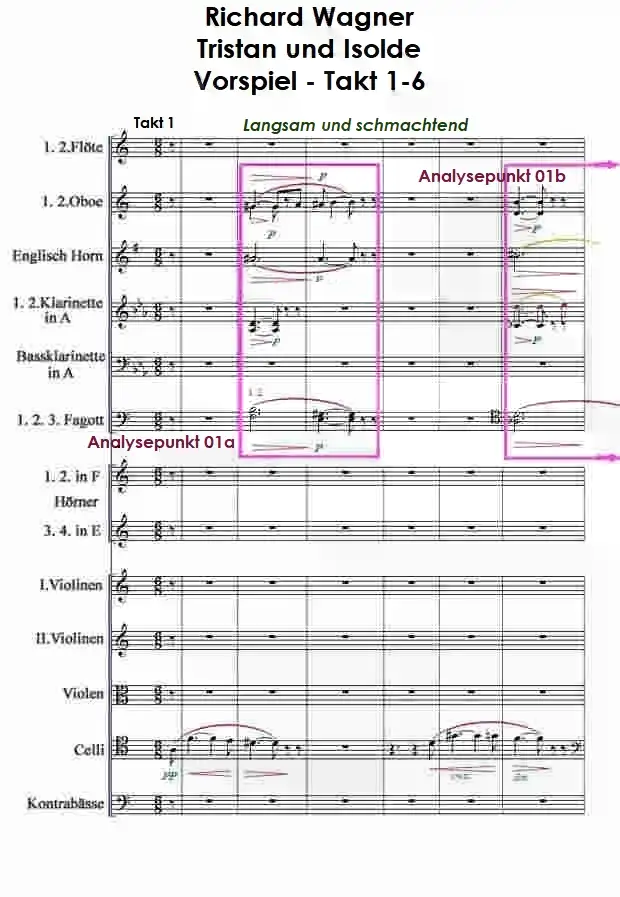
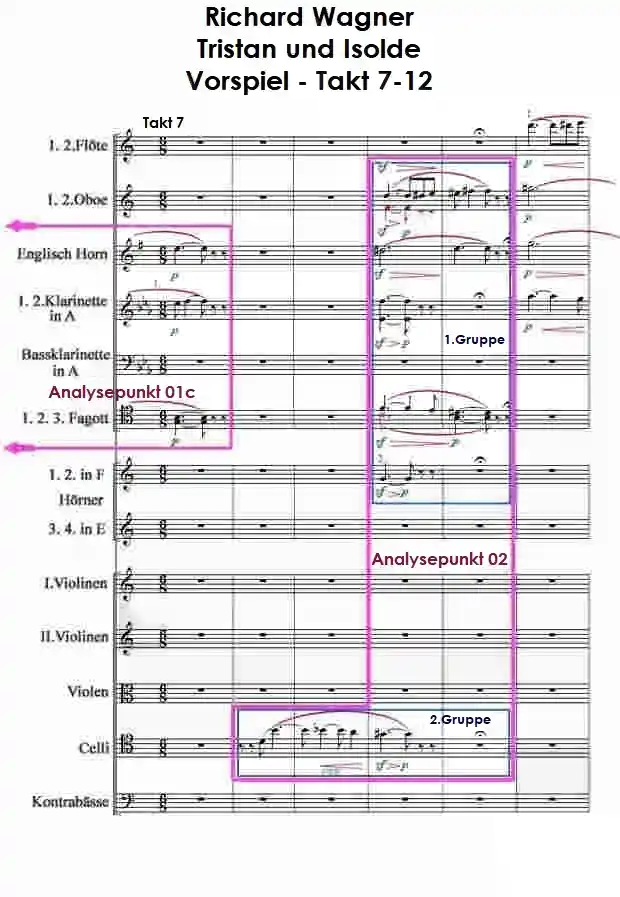
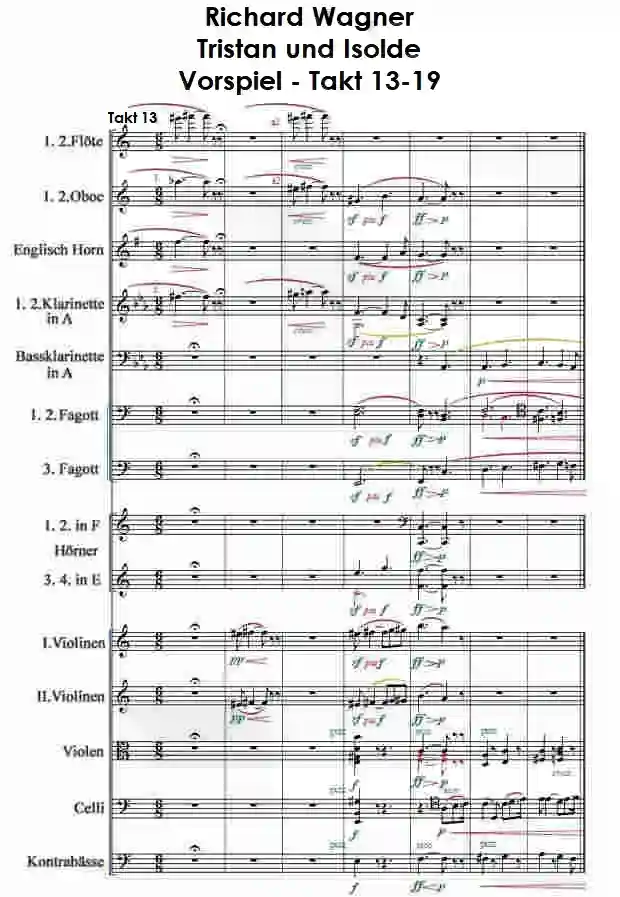
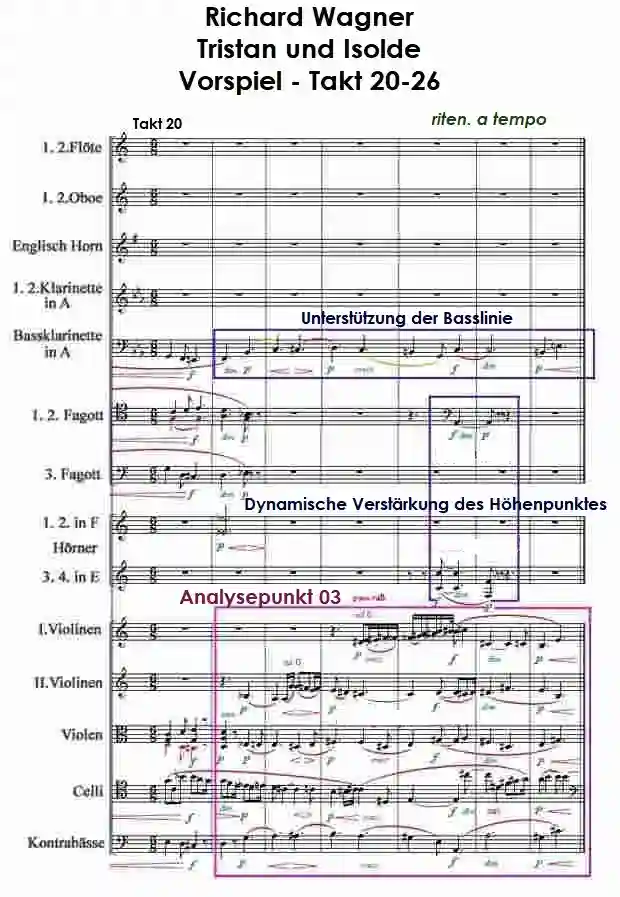
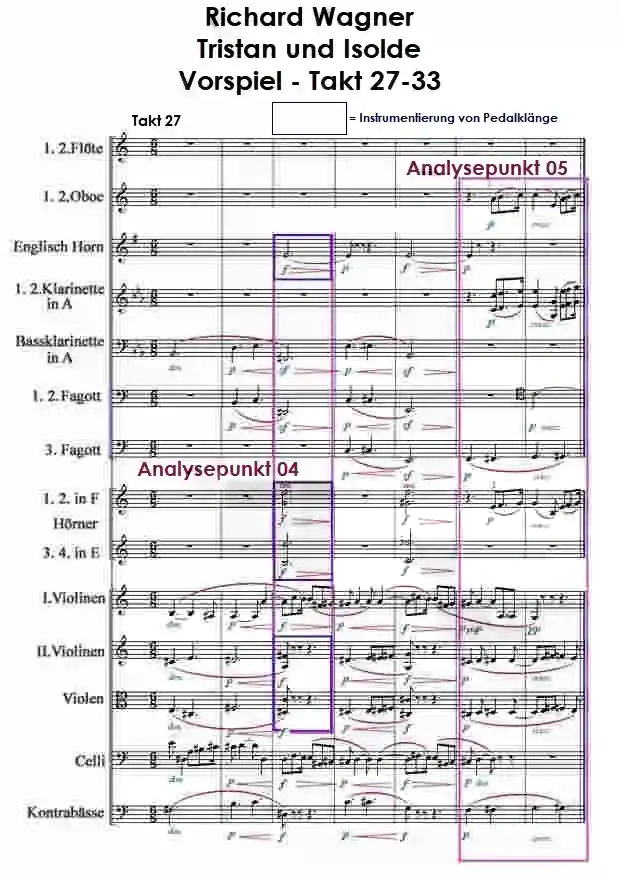
Interne Suchfunktion
| Name | Wert | Löschen |
|---|